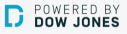Von Selina Cheng
HONGKONG (Dow Jones)--Die Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge, die Europa jetzt verhängen will, kommen für die betroffenen Hersteller nicht überraschend. Sie haben sich auf ein solches Szenario in einem ihrer vielversprechendsten Märkte seit Monaten vorbereitet.
Einzelne Produzenten haben bereits begonnen, Fabriken vor Ort in Europa zu bauen, andere gründeten Gemeinschaftsunternehmen mit europäischen Anbietern. Wieder andere erwägen, aus Drittländern wie Thailand nach Europa zu exportieren, während einige mit Blick auf Europa das Handtuch werfen und sich auf Märkte konzentrieren, wo sie bessere Chancen sehen, die etablierten Hersteller zu verdrängen.
Ende vergangenen Jahres hatte die Europäische Union eine Untersuchung zu der Frage eingeleitet, ob Subventionen des chinesischen Staates den dortigen Herstellern von Elektrofahrzeugen unfaire Vorteile verschafft haben. Am Mittwoch bejahte die EU dies nun und teilte den Autoherstellern mit, dass auf Importe von Elektrofahrzeugen zusätzliche Zölle von bis zu 38 Prozent erhoben werden könnten, zusätzlich zu einer bereits bestehenden Abgabe von 10 Prozent - vorausgesetzt, sie setzt ihre Pläne Anfang Juli auch in die Tat um.
Das Ergebnis war erwartet worden, es durchkreuzt dennoch die Pläne vieler chinesischer Elektroautohersteller, die ihren Erfolg im Heimatland in eine globale Vormachtstellung ummünzen wollten. Peking hat über Jahre die weltweit weitreichendste Lieferkette für Elektroautos aufgebaut. Viele der dortigen chinesischen Hersteller hegten nun den Ehrgeiz, das nächste Tesla oder der Nachfolger von Toyota als Massenhersteller zu werden. Für solche Pläne ist es aber unabdingbar, in entwickelten Märkten wie Europa und Nordamerika Fuß zu fassen. Jetzt überdenken viele ihre Strategie.
Europa für Globalisierungsstrategie unverzichtbar
Im Mai erklärte die US-Regierung, sie wolle die Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge auf 100 Prozent erhöhen. Im Vergleich dazu nehmen sich die Pläne Europas weniger entmutigend aus. Mehrere führende chinesische E-Auto-Unternehmen, darunter das von Investorenlegende Warren Buffett unterstützte BYD und die in den USA börsennotierte NIO, haben bereits Millionen Dollar in Europa investiert, wo sie ihre Fahrzeuge zu höheren Preisen verkaufen können als in ihrer Heimat. Dies ist insofern entscheidend, als sich die Verkäufe von Elektroautos in China zuletzt verlangsamt haben, nachdem im vergangenen Jahr landesweit gezahlte Subventionen für den Kauf ausgelaufen sind und sich die chinesische Konjunktur insgesamt abgekühlt hat. Alles zusammen hat die Begeisterung der chinesischen Verbraucher für Elektroautos gedämpft und einen brutalen Preiskrieg nach sich gezogen.
He Yadong, ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, bezeichnete den jetzigen Schritt der EU als "unverhohlenen Protektionismus" und sagte am Donnerstag, dass er möglicherweise auch gegen die Regeln der Welthandelsorganisation verstoße. Ding Weishun, ein weiterer Vertreter des Ministeriums, hatte am Vortag auf einer Pressekonferenz den Einsatz von Subventionen eingeräumt, diese jedoch als alltäglich und im Einklang mit internationalem Recht bezeichnet. Die EU-Untersuchung bezeichnete er als "einen neuen Trick der Doppelmoral und des Handelsschutzes".
Europas Zoll-Entscheidung stützt frühere Entscheidungen der chinesischen Hersteller BYD, Chery und Leapmotor, die ihre Produktion in Europa ausbauen wollen, wodurch sie Importzölle wohl vermeiden können. Great Wall Motor, ein Hersteller, der bislang in Europa keine großen Fortschritte gemacht hat, leitete angesichts wahrscheinlicher Zölle bereits einen taktischen Rückzug ein. Der Hersteller, der in China mit BMW ein Joint Venture unterhält, kündigte im Mai an, er werde seine Europazentrale in Deutschland drei Jahre nach dessen Eröffnung wieder schließen. Europas Markt für Elektrofahrzeuge habe sich zu einer "zunehmenden Herausforderung" entwickelt, hieß es. Wegen "zahlreicher Unwägbarkeiten in der Zukunft" beschränke sich Great Wall darauf, seine bisherigen Händler und Kunden auf dem Kontinent zu unterstützen und konzentriere sich auf die Erschließung neuer Märkte.
Zölle werden Chinas Anbieter nur kurzfristig bremsen
Europas Maßnahmen dürften den Absatz chinesischer Elektroautos nur vorübergehend bremsen, die meisten Hersteller aber längerfristig nicht von ihrem Kurs abbringen - zumal in Ländern ohne eigene Anbieter, die geschützt werden müssen. "Dies ist kein schwarzer Schwan", sagte Yichao Zhang, ein in Hongkong ansässiger Automobilberater bei AlixPartners. "Insgesamt hat sich an der Richtung für chinesische Hersteller in der neuen Ära des Automobils nichts geändert."
Führende Elektroautobauer wie BYD würden weiterhin in Europa bleiben, sagte Zhang, schon wegen der großen Investitionen, die sie dort bereits getätigt haben. Ein oder zwei von ihnen würden sich über kurz oder lang zu globalen Marken entwickeln, die in denselben Ländern produzieren, in denen sie auch verkaufen - so wie die etablierten Großkonzerne es auch täten, fügte Zhang hinzu.
BYD betreibt schon seit Jahren Fabriken für Elektrobusse in den USA und Europa. Es war aber auch eines der ersten chinesischen Unternehmen, das Pläne für den Bau eines europäischen Werks für Elektroautos bekannt gab. Anfang vergangenen Jahres wurde mit der Suche nach einem geeigneten Standort begonnen. Seit Dezember ist klar, dass das erste europäische BYD-Werk für Elektro-Pkw in Ungarn eröffnet werden soll. Chinesische Firmen sind in dem osteuropäischen Land sehr willkommen. BYD fertigt dort seit 2017 Elektrobusse für den europäischen Markt.
Im Rahmen des angedrohten EU-Regimes würden E-Fahrzeuge von BYD mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von rund 17 Prozent belegt. Der Geländewagen Atto 3, der derzeit bei einem Händler in Deutschland rund 38.000 Euro kostet, wäre auch dann noch rund 4 Prozent günstiger als der vergleichbare ID.4 Pro von Volkswagen, wenn die vorgeschlagenen Zölle in Kraft träten. Analysten verweisen darauf, dass BYD vermehrt Plug-in-Hybride nach Europa einführen könnte. In dieser Fahrzeugkategorie ist das Unternehmen ebenfalls stark, und hier drohen keine zusätzlichen Zölle.
Leapmotor und Chery, zwei chinesische Autofirmen, die sich mit Verkäufen in Europa bisher zurückgehalten haben, drängen nun mit Hilfe lokaler Partner voran. Der erstgenannte Hersteller mit Börsennotierung in Hongkong bietet Elektroautos im unteren Preissegment an und hat sich mit der Opel-Muttergesellschaft Stellantis zusammengetan. Beide Firmen verkündeten kürzlich, ein neues Joint Venture werde ab September Leapmotor-Autos in neun europäischen Ländern verkaufen. Das Joint Venture wird ungenutzte Produktionskapazitäten von Stellantis nutzen, um Elektrofahrzeuge für Europa zu produzieren, wie ein Mitarbeiter von Leapmotor dem Wall Street Journal sagte. Weil Stellantis 51 Prozent an dem Joint Venture hält, hat es gute Chancen, als europäisches Unternehmen anerkannt zu werden, so der Manager.
Chery mit Sitz in der ostchinesischen Provinz Anhui hat sich unterdessen mit einem spanischen Partner, Ebro-EV Motors, zusammengetan, und will Autos in Barcelona montieren. Die Marke hat im vergangenen Jahr keine Elektroautos in der EU verkauft, konnte aber steigende Verkaufszahlen in Märkten wie Mexiko und Australien verzeichnen.
SAIC macht mit der Marke MG Furore
Der größte chinesische Elektroautohersteller, der nach Europa exportiert, ist unterdessen nicht BYD, sondern die Shanghai Automotive Industry (Group) Corp, kurz SAIC, die sich vollständig im Eigentum der Regierung von Shanghai befindet. Das Unternehmen, dem die britischen Traditionsmarken MG und Maxus gehören, wäre nach den Plänen aus Brüssel mit zusätzlichen Zöllen von bis zu 38,1 Prozent konfrontiert. 2023 war der MG4, ein kompaktes Auto, die Nummer vier in der Reihe der meistverkauften Elektroautos in Europa - inklusive Großbritannien und Russland - nach den Tesla-Modellen Y und 3 sowie dem Skoda Enyaq, wie Zahlen des Londoner Marktforschungsunternehmen GlobalData zeigten. Ihnen zufolge wurden im vergangenen Jahr mehr als 80.000 Elektroautos der Marke MG in der EU verkauft.
MG produziert Elektroautos auch in Thailand. Das südasiatische Land hat sich zu einem wichtigen Produktionszentrum für chinesische Autohersteller im Ausland entwickelt. SAIC-Führungskräfte sagen, dass die thailändische Fabrik von MG in der Lage sei, den europäischen Markt zu beliefern. Das könnte helfen, die Zölle zu umgehen.
Als Reaktion auf die Zollankündigung aus Brüssel bekräftigte SAIC Überlegungen, eines Tages eine Fabrik in Europa zu errichten; konkrete Pläne oder einen möglichen Standort gibt es aber noch nicht. SAIC wies zurück, dass der Erfolg mit der Marke MG das Ergebnis einer Unterstützung durch staatliche Stellen sei. Man habe in den zurückliegenden zehn Jahren mehr als 20 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung investiert und biete "wegen technischer Innovation und nicht wegen staatlicher Subventionen" Autokäufern weltweit Qualitätsprodukte an.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/brb
(END) Dow Jones Newswires
June 13, 2024 10:43 ET (14:43 GMT)